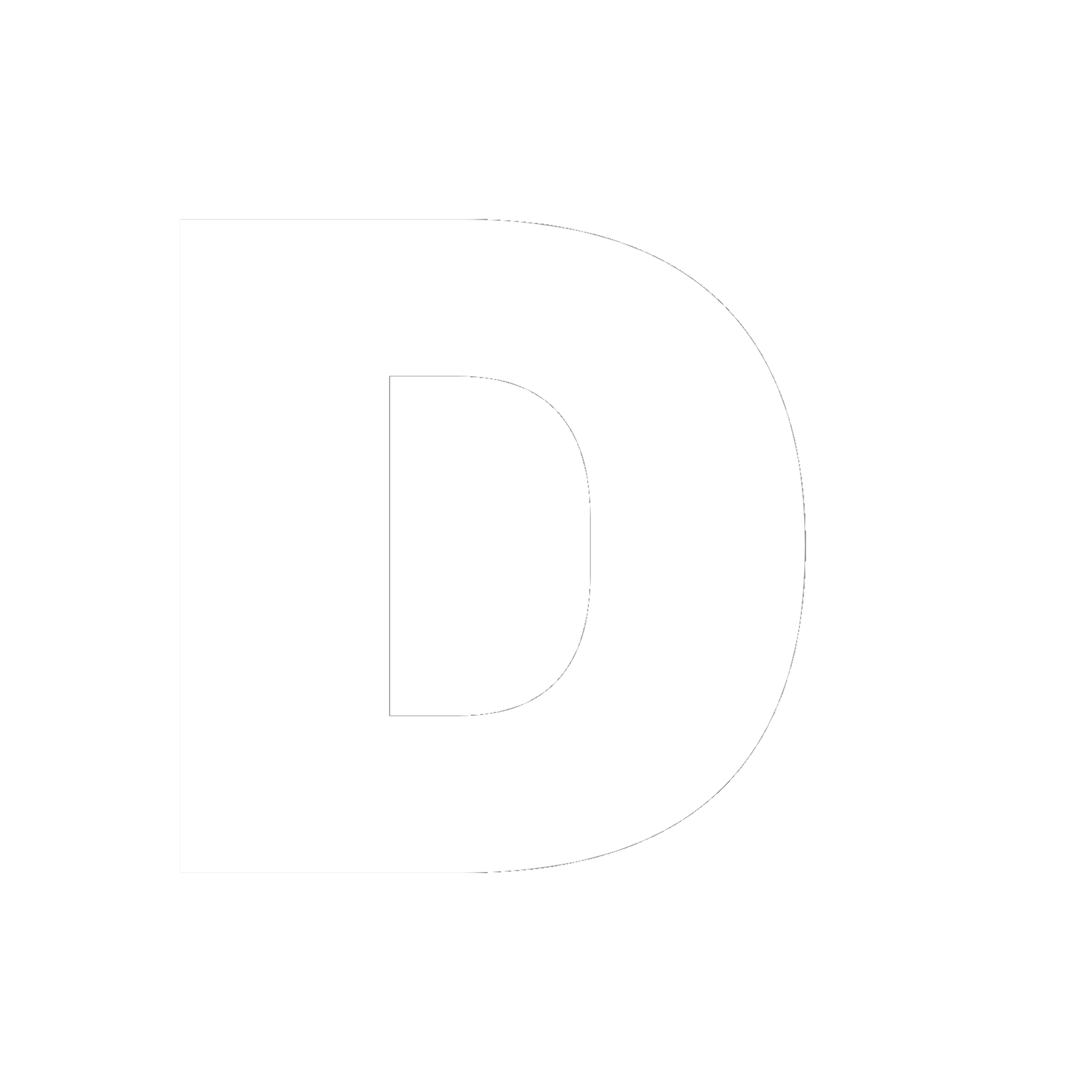Von Paris und London über New York bis Tokio: Die Lieder von Leslie Mandoki und seiner „Supergroup“, die Mandoki Soulmates, finden weltweit Gehör. Kürzlich ist eine limitierte Deluxe Edition des Albums „A Memory Of Our Future“ auf White-Vinyl erschienen.
Im Interview mit unserer Redaktion spricht der 71-Jährige über die „Enkelkinder von Woodstock“ und erklärt, wie uns seine Soulmates aus dem „Labyrinth der Krisen“ herausführen sollen.
Zudem erinnert Mandoki an den verstorbenen Michael-Jackson-Produzenten
Herr Mandoki, die Geschichte Ihres aktuellen Albums „A Memory Of Our Future“ ist noch nicht auserzählt. So werden bis Ende des Jahres weitere Musikvideos und Konzertfilme der Mandoki Soulmates veröffentlicht. Haben Sie sich selbst um eine ruhige Vorweihnachtszeit gebracht?
Leslie Mandoki: Das mag so sein, doch ein Künstler sucht niemals nach Ruhe. In dieser schwermütigen Zeit, in der die Brückenbauer fehlen, haben wir Künstler die verdammte Verpflichtung, dem Publikum respektvoll etwas zurückzugeben – für seine jahrzehntelange Liebe und dafür, dass es uns bis heute auf Händen trägt. Ich bin also eher stolz darauf, dass ich keine ruhige Vorweihnachtszeit habe, sondern zwischen New York, Tokio, Seoul, Paris und London hin- und herreisen darf. Vor allem in New York durfte ich zuletzt viel Zeit verbringen, weil amerikanische Medienvertreter und Songwriter „A Memory Of Our Future“ zum „wichtigsten Album des Jahres“ erklärt haben.
Ist die internationale Relevanz des Albums eine Genugtuung für Sie?
Eher eine Bestätigung. Mich beflügelt der Gedanke, dass es uns „Enkelkindern von Woodstock“ vielleicht gelungen ist, dem Publikum zu zeigen, dass Licht am Ende des dunklen Tunnels ist. Im Grunde genommen ist jetzt das wahr geworden, was ich immer versucht habe, deutlich zu machen: nämlich, dass ich gar nicht derjenige bin, der die Songs schreibt. Ich habe lediglich das ehrenvolle Privileg, das aufschreiben und in Songs manifestieren zu dürfen, was das Leben uns offeriert. Meine Erkenntnis ist, dass wir auch in herausfordernden Zeiten wie diesen sehr wohl zur Musik zurückkehren und mit ihrer Hilfe Zuversicht, Optimismus sowie Haltung transportieren können. Unser Album ist ein Kompass, der uns aus diesem Labyrinth der Krisen herausführen soll.
Sie sind 1953 in Ungarn geboren worden und haben in der Vergangenheit ähnlich herausfordernde Zeiten miterlebt. Lassen Sie Ihre eigenen Erfahrungen heute mehr denn je in Ihre Musik einfließen?
Musik hat mir schon immer Kraft verliehen. So war das auch, als damals mein Vater an Krebs gestorben ist. Ich war damals 16 und fühlte mich während der russisch geprägten Diktatur einsam und erdrückt. Als ich dieses Album schrieb, erinnerte ich mich an die Dramen zurück, die ich als Teenager zu Zeiten der russischen Besatzung erlebt hatte – an die Zensur und alles, was damit einhergegangen war. Heute sage ich: 1989 (der Fall des Eisernen Vorhangs; Anm. d. Red.) regnete es Glück vom Himmel. Und ich frage mich, was meine Generation alles falsch gemacht haben muss, dass wir jetzt wieder in diese schweren Fahrwasser geraten sind.
Was ist zu tun, um diese „schweren Fahrwasser“ mit etwas mehr Zuversicht zu begegnen?
Wir brauchen wieder mehr Freidenker – auch in Deutschland. Und Freidenker haben einen Soundtrack: den Prog-Rock. Genau darüber habe ich mich schon mit Michail Gorbatschow unterhalten, als dieser vor ungefähr 15 Jahren ein Konzert von uns besuchte. Wir sprachen über die „Free Mind“-Musik, die von der sowjetischen Kulturpolitik einst zensiert beziehungsweise verboten worden war. Dazu gehörten natürlich auch viele Songs der späteren Gründungsmitglieder der Mandoki Soulmates.
Ian Anderson, Al Di Meola, Jack Bruce und Co.: Wie Mandoki seinen Traum von einer Supergroup umsetzte
Welche musikalischen Ziele hatten Sie in jungen Jahren?
Als ich 1975 – ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können – meinen Asylantrag abgab, fragten mich die Beamten, was ich denn in Deutschland machen wolle. Ich erzählte ihnen dann von meiner Idee, den britischen Prog-Rock mit seinen komplexen Kompositionen sowie seinen poetischen, gesellschaftspolitisch relevanten und teils rebellischen Texten mit dem amerikanischen Fusion Jazz verschmelzen zu lassen. Sie fragten mich nach einem Beispiel und ich antwortete, dass ich gerne eine Band mit Jack Bruce (verstarb 2014; Anm. d. Red.) von Cream, Ian Anderson von Jethro Tull und Al Di Meola von Return to Forever gründen würde. Diese Musiker waren damals stadionfüllende Superstars – sogar in den USA, obwohl Prog-Rock eine eher englische Musikart ist. Und genau diese Ikonen wurden dann vor 32 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Mandoki Soulmates.
32 Jahre später: Wie begegnen international bekannte Freidenker wie die Soulmates den Spaltungen, Kriegen und Trumps dieser Welt? Wie greifen Sie diese Themen auf?
Auf unseren amerikanischen Tourplakaten steht: „Music is the greatest unifier“ (auf Deutsch etwa: „Musik ist der größte Vereiniger“, Anm. d. Red.). Zuallererst wollen wir unsere musikalischen Stimmen gegen die Spaltung erheben. Dafür ist es auch notwendig, uns an unsere Teenager-Zeit zurückzuerinnern. Wenn damals diskutiert wurde, war derjenige, der eine gegenteilige Meinung vertrat, nicht der Feind, sondern einfach ein Mensch mit einer anderen Meinung. Und oft war das Ergebnis ein Diskurs, Erkenntnisgewinn und Erweiterung der eigenen Perspektive. Zudem hatten wir die Zeit, um uns Alben komplett anzuhören oder uns Filme in Gänze anzuschauen – ohne dabei ein Handy in der Hand zu halten. Unser Aufmerksamkeitsfenster war größer.
Insofern ist etwa unser Song „Devil’s Encyclopedia“ ein Aufruf gegen diese Verkürzung und undifferenzierte Wahrnehmung in der eigenen Echokammer. Nur wenn wir versuchen, beide Seiten zu verstehen, können wir Brücken bauen – selbst dann, wenn die Brückenpfeiler vor Spaltung und Hass kaum noch sichtbar sind. Dafür sind wir da. Das meint „Music is the greatest unifier“. Die Zuversicht besteht darin, wieder eine neue Streitkultur in der Mitte der Gesellschaft zu entfachen. Wir dürfen durchaus mal Dinge hinterfragen. Und wir dürfen auch widersprechen. Andere Ideen, die ich selbst ablehne, müssen noch lange keine feindlichen Ideen sein.
Ein Musiker steht immer dort, wo die Opfer sind.
Sondern?
Es sind einfach andere Ideen, die außerhalb meiner Filterblase entstanden sind, denen ich möglicherweise argumentativ begegne und zu denen ich sage: Das ist nicht mein Weg. Aber wir dürfen es sehr wohl in der Mitte der Gesellschaft erkennen, wenn wir die Streitkultur außerhalb der Mitte verlagern, dann haben wir die Probleme, die wir jetzt auch sehen. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir Künstler uns an der Lebensrealität unseres Publikums orientieren müssen bei unserer zu Recht progressiven Meinungsbildung. Wo und wofür steht ein Musiker? Ein Musiker steht immer dort, wo die Opfer sind. Ein Musiker steht immer dort, wo Dunkelheit herrscht – und wir müssen dann die Fackel der Menschlichkeit dort hinbringen.
In Ihren Worten schwingt eine Menge Zuversicht mit. Warum ziert dann ein Trauerschwan das Cover von „A Memory Of Our Future“?
Weil ich möchte, dass sich dieser schwarze Schwan am Ende eines jeden Konzertes wieder in einen weißen Schwan verwandelt. Wenn das Publikum mit diesem Gefühl in den Herzen nach Hause geht, dann bin ich glücklich. Denn genau das ist unsere Botschaft – auch mit Blick auf das 80-minütige Album. Dementsprechend wird diese Metapher bei unseren Konzerten auch im Hintergrund visuell umgesetzt. Wir müssen die Dinge überwinden, kraftvoll anpacken und Zuversicht verbreiten. Dafür steht dieses Album.
Lesen Sie auch
Sie wünschen sich wieder mehr Freidenker in Deutschland. Wie haben Sie dieses Land einst kennengelernt? Und welche deutschen Künstler haben Sie inspiriert?
Ich kam aus einer von Russen besetzten militanten Diktatur in dieses wunderbare, friedfertige, pazifistische Deutschland. Als ich das erste Mal an einem Friedensmarsch teilnahm, fühlte ich mich wie im Paradies. Dieser gelebte Pazifismus war übrigens die Ur-DNA der Grünen. Und mein langjähriger Soulmate Udo Lindenberg schrieb die Hymne dazu: „Wozu sind Kriege da?“ All das hat dazu beigetragen, dass ich ein stolzer Bürger seiner „Bunte Republik Deutschland“ geworden bin.
In Ungarn geboren, in der Welt zu Hause: So hat Mandoki Deutsch gelernt
Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Auf der linken Seite des Tisches lag die „Süddeutsche Zeitung“, auf der rechten Seite die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. In der Mitte des Tisches lag ein Wörterbuch. Die beiden Tageszeitungen waren nur bei zwei Dingen einer Meinung: beim Wetterbericht und beim Fernsehprogramm. In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich in einem pluralistischen Paradies angekommen bin.
Im Mittelpunkt des cineastischen Videos zur aktuellen Single „The Wanderer“ steht ein junger Mann, der sein Zuhause verlässt und die große, weite Welt zieht. Sehen wir dort quasi den jungen Leslie Mandoki?
Dieser Song hat autobiografische Züge, aber dieses Abkapseln muss nicht immer so dramatisch ablaufen wie in meinem Fall – also mit Blick auf meinen zu früh verstorbenen Vater, der mir noch mit auf den Weg gegeben hat, meinen Traum zu leben und nicht mein Leben zu träumen. Er war ein Freiheitskämpfer und wollte, dass seine Enkelkinder niemals zensierte Zeitungen lesen müssen. Ich habe mein Geburtsland und meine Familie mit 22 verlassen müssen, weil meine Sehnsucht nach Freiheit stärker war als alles andere.
Grundsätzlich ist das Verlassen des Elternhauses für jeden jungen Menschen ein einschneidendes Momentum. Schließlich weiß man, dann man nicht mehr zurückkommen wird – mit Ausnahme von Besuchen natürlich, was bei mir nicht möglich war, da Republikflucht unter schwerer Strafe stand. Darum geht es in „The Wanderer“. Der Song erzählt aber auch die andere Seite, nämlich die des Vaters. Ich habe immer versucht, meinen drei Kindern tiefe Wurzeln zu vermitteln und ihnen starke Flügel zu verleihen. Irgendwann sind diese Flügel nun einmal stark genug, um zu fliegen. Dieser Moment hat dann auch für die Eltern schmerzhafte Aspekte.
Anfang November verstarb mit Quincy Jones (u.a. „Thriller“ von Michael Jackson) einer der erfolgreichsten Musikproduzenten. Wie werden Sie Ihren Kollegen und guten Freund in Erinnerung behalten?
Quincy war ein Genie. Die meisten Produzenten haben einen wiedererkennbaren Stil. Dafür sind sie bekannt und diesen musikalischen Stempel drücken sie jedem ihrer Künstler auf. Quincy Jones aber war anders. Er hat seine unglaublichen Fähigkeiten immer in den Dienst der Musik oder der Künstlerinnen und Künstler gestellt. Anstatt eines Quincy-Jones-Albums hat er ein Michael- Jackson-Album oder ein Nana-Mouskouri-Album produziert, weil er eben auch großartige eigene Alben erschaffen hat. Er war immer stilführend. Vor allem aber werde ich Quincy als einen unglaublich herzlichen und liebevollen Menschen in Erinnerung behalten.
Was haben Sie ihm alles zu verdanken?
Nach der Beerdigung von Jack Bruce rief mich Quincy an und sagte: „Du sitzt wahrscheinlich gerade mit Eric Clapton in London beim Leichenschmaus. Du brauchst jetzt einen neuen Bassisten. Wir sehen uns in vier Tagen in New York. Dort werde ich dir Richard Bona vorstellen.“ Als Jon Lord von Deep Purple tragischerweise von uns gegangen ist (2012; Anm. d. Red.), hat er uns Cory Henry empfohlen. Cory ist ein Genie, von damals noch nicht einmal 30 Jahren, der zu diesem Zeitpunkt bereits drei Grammys gewonnen hatte. Seinen 30. Geburtstag feierten wir bei einem Soulmates-Konzert im Pariser Olympia. Auch meine Musikertochter Julia hat Quincy immer sehr gelobt. Ja, es ist ein großartiger Mensch von uns gegangen. Er war ein Leuchtturm im Musikbusiness.
Mandoki über Grand-Prix-Teilnahme mit Dschinghis Khan: „Habe meinen Kindern nie erzählt, dass …“
1979 haben Sie mit Dschinghis Khan und dem Ralph-Siegel-Song „Moskau“ beim Grand Prix den vierten Platz erreicht. Können Sie dank der Erfüllung, die Sie durch die Mandoki Soulmates erfahren haben, heute über die Schlager von damals hinwegsehen?
Ja, natürlich. Ich habe diese Lieder zwar seit über 40 Jahren nicht mehr gesungen, beantworte diese Frage aber gerne mit einer kleinen Anekdote. Als unsere erstgeborene Tochter Lara, die heute eine großartige Schauspielerin ist, fünf Jahre alt war, hat sie mal unsere Bibliothek auseinandergenommen. Ich kam gerade vom Tonstudio nach Hause, alles lag auf dem Boden – darunter auch ein Buch über die Gruppe Dschinghis Khan. Sie war überrascht, mich in diesen Kostümen zu sehen, weil sie wusste, dass ich eigentlich ein Faschingsmuffel war. Sie sagte zu mir: „Du magst doch keinen Karneval.“ Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass ich meinen Kindern nie erzählt hatte, dass ich mal ein Pop- oder Schlagerstar war. Heute kann ich sehr entspannt darüber sprechen und muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke.
Warum waren Sie eigentlich nie Jurymitglied in einer Castingshow?
Ich hätte keine Freude daran, junge Menschen, die sich dort präsentieren, niederzumachen. Mein Berufsethos nehme ich sehr ernst. Ich habe überhaupt nichts gegen meine Kollegen, die in Jurys sitzen. Aber für mich sind Castingshows eher Fernsehformate, die mit Musik wenig zu tun haben. Meine Plattform ist das nicht. Ich fördere Talente lieber im stillen Kämmerlein in meinem Tonstudio, und freue mich, wenn wir ein gutes Debütalbum erarbeiten können, das beim Publikum Anklang findet. Ich produzierte zum Beispiel die No Angels, die allererste Gruppe, die durch eine Castingshow entstand.
Über den Gesprächspartner
- Leslie Mandoki ist ein ungarisch-deutscher Musiker und Musikproduzent. Im Jahr 1953 in Budapest geboren, verließ er Mitte der 70er-Jahre sein Heimatland über Österreich nach Deutschland. Bekanntheit erlangte er als Mitglied der von Ralph Siegel produzierten Band Dschinghis Khan, die beim damaligen Grand Prix Eurovision de la Chanson mit dem Lied „Moskau“ den vierten Platz belegte. Im Jahr 1992 gründete er sein musikalisches Projekt, die Mandoki Soulmates. In seiner Karriere arbeitete Mandoki mit nationalen und internationalen Stars zusammen, darunter Engelbert, Phil Collins, Jennifer Rush oder Lionel Richie.


„So arbeitet die Redaktion“ informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.
Von Paris und London über New York bis Tokio: Die Lieder von Leslie Mandoki und seiner „Supergroup“, die Mandoki Soulmates, finden weltweit Gehör. Kürzlich ist eine limitierte Deluxe Edition des Albums „A Memory Of Our Future“ auf White-Vinyl erschienen.
Im Interview mit unserer Redaktion spricht der 71-Jährige über die „Enkelkinder von Woodstock“ und erklärt, wie uns seine Soulmates aus dem „Labyrinth der Krisen“ herausführen sollen.
Zudem erinnert Mandoki an den verstorbenen Michael-Jackson-Produzenten
Herr Mandoki, die Geschichte Ihres aktuellen Albums „A Memory Of Our Future“ ist noch nicht auserzählt. So werden bis Ende des Jahres weitere Musikvideos und Konzertfilme der Mandoki Soulmates veröffentlicht. Haben Sie sich selbst um eine ruhige Vorweihnachtszeit gebracht?
Leslie Mandoki: Das mag so sein, doch ein Künstler sucht niemals nach Ruhe. In dieser schwermütigen Zeit, in der die Brückenbauer fehlen, haben wir Künstler die verdammte Verpflichtung, dem Publikum respektvoll etwas zurückzugeben – für seine jahrzehntelange Liebe und dafür, dass es uns bis heute auf Händen trägt. Ich bin also eher stolz darauf, dass ich keine ruhige Vorweihnachtszeit habe, sondern zwischen New York, Tokio, Seoul, Paris und London hin- und herreisen darf. Vor allem in New York durfte ich zuletzt viel Zeit verbringen, weil amerikanische Medienvertreter und Songwriter „A Memory Of Our Future“ zum „wichtigsten Album des Jahres“ erklärt haben.
Ist die internationale Relevanz des Albums eine Genugtuung für Sie?
Eher eine Bestätigung. Mich beflügelt der Gedanke, dass es uns „Enkelkindern von Woodstock“ vielleicht gelungen ist, dem Publikum zu zeigen, dass Licht am Ende des dunklen Tunnels ist. Im Grunde genommen ist jetzt das wahr geworden, was ich immer versucht habe, deutlich zu machen: nämlich, dass ich gar nicht derjenige bin, der die Songs schreibt. Ich habe lediglich das ehrenvolle Privileg, das aufschreiben und in Songs manifestieren zu dürfen, was das Leben uns offeriert. Meine Erkenntnis ist, dass wir auch in herausfordernden Zeiten wie diesen sehr wohl zur Musik zurückkehren und mit ihrer Hilfe Zuversicht, Optimismus sowie Haltung transportieren können. Unser Album ist ein Kompass, der uns aus diesem Labyrinth der Krisen herausführen soll.
Sie sind 1953 in Ungarn geboren worden und haben in der Vergangenheit ähnlich herausfordernde Zeiten miterlebt. Lassen Sie Ihre eigenen Erfahrungen heute mehr denn je in Ihre Musik einfließen?
Musik hat mir schon immer Kraft verliehen. So war das auch, als damals mein Vater an Krebs gestorben ist. Ich war damals 16 und fühlte mich während der russisch geprägten Diktatur einsam und erdrückt. Als ich dieses Album schrieb, erinnerte ich mich an die Dramen zurück, die ich als Teenager zu Zeiten der russischen Besatzung erlebt hatte – an die Zensur und alles, was damit einhergegangen war. Heute sage ich: 1989 (der Fall des Eisernen Vorhangs; Anm. d. Red.) regnete es Glück vom Himmel. Und ich frage mich, was meine Generation alles falsch gemacht haben muss, dass wir jetzt wieder in diese schweren Fahrwasser geraten sind.
Was ist zu tun, um diese „schweren Fahrwasser“ mit etwas mehr Zuversicht zu begegnen?
Wir brauchen wieder mehr Freidenker – auch in Deutschland. Und Freidenker haben einen Soundtrack: den Prog-Rock. Genau darüber habe ich mich schon mit Michail Gorbatschow unterhalten, als dieser vor ungefähr 15 Jahren ein Konzert von uns besuchte. Wir sprachen über die „Free Mind“-Musik, die von der sowjetischen Kulturpolitik einst zensiert beziehungsweise verboten worden war. Dazu gehörten natürlich auch viele Songs der späteren Gründungsmitglieder der Mandoki Soulmates.
Ian Anderson, Al Di Meola, Jack Bruce und Co.: Wie Mandoki seinen Traum von einer Supergroup umsetzte
Welche musikalischen Ziele hatten Sie in jungen Jahren?
Als ich 1975 – ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können – meinen Asylantrag abgab, fragten mich die Beamten, was ich denn in Deutschland machen wolle. Ich erzählte ihnen dann von meiner Idee, den britischen Prog-Rock mit seinen komplexen Kompositionen sowie seinen poetischen, gesellschaftspolitisch relevanten und teils rebellischen Texten mit dem amerikanischen Fusion Jazz verschmelzen zu lassen. Sie fragten mich nach einem Beispiel und ich antwortete, dass ich gerne eine Band mit Jack Bruce (verstarb 2014; Anm. d. Red.) von Cream, Ian Anderson von Jethro Tull und Al Di Meola von Return to Forever gründen würde. Diese Musiker waren damals stadionfüllende Superstars – sogar in den USA, obwohl Prog-Rock eine eher englische Musikart ist. Und genau diese Ikonen wurden dann vor 32 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Mandoki Soulmates.
32 Jahre später: Wie begegnen international bekannte Freidenker wie die Soulmates den Spaltungen, Kriegen und Trumps dieser Welt? Wie greifen Sie diese Themen auf?
Auf unseren amerikanischen Tourplakaten steht: „Music is the greatest unifier“ (auf Deutsch etwa: „Musik ist der größte Vereiniger“, Anm. d. Red.). Zuallererst wollen wir unsere musikalischen Stimmen gegen die Spaltung erheben. Dafür ist es auch notwendig, uns an unsere Teenager-Zeit zurückzuerinnern. Wenn damals diskutiert wurde, war derjenige, der eine gegenteilige Meinung vertrat, nicht der Feind, sondern einfach ein Mensch mit einer anderen Meinung. Und oft war das Ergebnis ein Diskurs, Erkenntnisgewinn und Erweiterung der eigenen Perspektive. Zudem hatten wir die Zeit, um uns Alben komplett anzuhören oder uns Filme in Gänze anzuschauen – ohne dabei ein Handy in der Hand zu halten. Unser Aufmerksamkeitsfenster war größer.
Insofern ist etwa unser Song „Devil’s Encyclopedia“ ein Aufruf gegen diese Verkürzung und undifferenzierte Wahrnehmung in der eigenen Echokammer. Nur wenn wir versuchen, beide Seiten zu verstehen, können wir Brücken bauen – selbst dann, wenn die Brückenpfeiler vor Spaltung und Hass kaum noch sichtbar sind. Dafür sind wir da. Das meint „Music is the greatest unifier“. Die Zuversicht besteht darin, wieder eine neue Streitkultur in der Mitte der Gesellschaft zu entfachen. Wir dürfen durchaus mal Dinge hinterfragen. Und wir dürfen auch widersprechen. Andere Ideen, die ich selbst ablehne, müssen noch lange keine feindlichen Ideen sein.
Ein Musiker steht immer dort, wo die Opfer sind.
Sondern?
Es sind einfach andere Ideen, die außerhalb meiner Filterblase entstanden sind, denen ich möglicherweise argumentativ begegne und zu denen ich sage: Das ist nicht mein Weg. Aber wir dürfen es sehr wohl in der Mitte der Gesellschaft erkennen, wenn wir die Streitkultur außerhalb der Mitte verlagern, dann haben wir die Probleme, die wir jetzt auch sehen. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir Künstler uns an der Lebensrealität unseres Publikums orientieren müssen bei unserer zu Recht progressiven Meinungsbildung. Wo und wofür steht ein Musiker? Ein Musiker steht immer dort, wo die Opfer sind. Ein Musiker steht immer dort, wo Dunkelheit herrscht – und wir müssen dann die Fackel der Menschlichkeit dort hinbringen.
In Ihren Worten schwingt eine Menge Zuversicht mit. Warum ziert dann ein Trauerschwan das Cover von „A Memory Of Our Future“?
Weil ich möchte, dass sich dieser schwarze Schwan am Ende eines jeden Konzertes wieder in einen weißen Schwan verwandelt. Wenn das Publikum mit diesem Gefühl in den Herzen nach Hause geht, dann bin ich glücklich. Denn genau das ist unsere Botschaft – auch mit Blick auf das 80-minütige Album. Dementsprechend wird diese Metapher bei unseren Konzerten auch im Hintergrund visuell umgesetzt. Wir müssen die Dinge überwinden, kraftvoll anpacken und Zuversicht verbreiten. Dafür steht dieses Album.
Lesen Sie auch
Sie wünschen sich wieder mehr Freidenker in Deutschland. Wie haben Sie dieses Land einst kennengelernt? Und welche deutschen Künstler haben Sie inspiriert?
Ich kam aus einer von Russen besetzten militanten Diktatur in dieses wunderbare, friedfertige, pazifistische Deutschland. Als ich das erste Mal an einem Friedensmarsch teilnahm, fühlte ich mich wie im Paradies. Dieser gelebte Pazifismus war übrigens die Ur-DNA der Grünen. Und mein langjähriger Soulmate Udo Lindenberg schrieb die Hymne dazu: „Wozu sind Kriege da?“ All das hat dazu beigetragen, dass ich ein stolzer Bürger seiner „Bunte Republik Deutschland“ geworden bin.
In Ungarn geboren, in der Welt zu Hause: So hat Mandoki Deutsch gelernt
Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Auf der linken Seite des Tisches lag die „Süddeutsche Zeitung“, auf der rechten Seite die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. In der Mitte des Tisches lag ein Wörterbuch. Die beiden Tageszeitungen waren nur bei zwei Dingen einer Meinung: beim Wetterbericht und beim Fernsehprogramm. In dem Moment wurde mir bewusst, dass ich in einem pluralistischen Paradies angekommen bin.
Im Mittelpunkt des cineastischen Videos zur aktuellen Single „The Wanderer“ steht ein junger Mann, der sein Zuhause verlässt und die große, weite Welt zieht. Sehen wir dort quasi den jungen Leslie Mandoki?
Dieser Song hat autobiografische Züge, aber dieses Abkapseln muss nicht immer so dramatisch ablaufen wie in meinem Fall – also mit Blick auf meinen zu früh verstorbenen Vater, der mir noch mit auf den Weg gegeben hat, meinen Traum zu leben und nicht mein Leben zu träumen. Er war ein Freiheitskämpfer und wollte, dass seine Enkelkinder niemals zensierte Zeitungen lesen müssen. Ich habe mein Geburtsland und meine Familie mit 22 verlassen müssen, weil meine Sehnsucht nach Freiheit stärker war als alles andere.
Grundsätzlich ist das Verlassen des Elternhauses für jeden jungen Menschen ein einschneidendes Momentum. Schließlich weiß man, dann man nicht mehr zurückkommen wird – mit Ausnahme von Besuchen natürlich, was bei mir nicht möglich war, da Republikflucht unter schwerer Strafe stand. Darum geht es in „The Wanderer“. Der Song erzählt aber auch die andere Seite, nämlich die des Vaters. Ich habe immer versucht, meinen drei Kindern tiefe Wurzeln zu vermitteln und ihnen starke Flügel zu verleihen. Irgendwann sind diese Flügel nun einmal stark genug, um zu fliegen. Dieser Moment hat dann auch für die Eltern schmerzhafte Aspekte.
Anfang November verstarb mit Quincy Jones (u.a. „Thriller“ von Michael Jackson) einer der erfolgreichsten Musikproduzenten. Wie werden Sie Ihren Kollegen und guten Freund in Erinnerung behalten?
Quincy war ein Genie. Die meisten Produzenten haben einen wiedererkennbaren Stil. Dafür sind sie bekannt und diesen musikalischen Stempel drücken sie jedem ihrer Künstler auf. Quincy Jones aber war anders. Er hat seine unglaublichen Fähigkeiten immer in den Dienst der Musik oder der Künstlerinnen und Künstler gestellt. Anstatt eines Quincy-Jones-Albums hat er ein Michael- Jackson-Album oder ein Nana-Mouskouri-Album produziert, weil er eben auch großartige eigene Alben erschaffen hat. Er war immer stilführend. Vor allem aber werde ich Quincy als einen unglaublich herzlichen und liebevollen Menschen in Erinnerung behalten.
Was haben Sie ihm alles zu verdanken?
Nach der Beerdigung von Jack Bruce rief mich Quincy an und sagte: „Du sitzt wahrscheinlich gerade mit Eric Clapton in London beim Leichenschmaus. Du brauchst jetzt einen neuen Bassisten. Wir sehen uns in vier Tagen in New York. Dort werde ich dir Richard Bona vorstellen.“ Als Jon Lord von Deep Purple tragischerweise von uns gegangen ist (2012; Anm. d. Red.), hat er uns Cory Henry empfohlen. Cory ist ein Genie, von damals noch nicht einmal 30 Jahren, der zu diesem Zeitpunkt bereits drei Grammys gewonnen hatte. Seinen 30. Geburtstag feierten wir bei einem Soulmates-Konzert im Pariser Olympia. Auch meine Musikertochter Julia hat Quincy immer sehr gelobt. Ja, es ist ein großartiger Mensch von uns gegangen. Er war ein Leuchtturm im Musikbusiness.
Mandoki über Grand-Prix-Teilnahme mit Dschinghis Khan: „Habe meinen Kindern nie erzählt, dass …“
1979 haben Sie mit Dschinghis Khan und dem Ralph-Siegel-Song „Moskau“ beim Grand Prix den vierten Platz erreicht. Können Sie dank der Erfüllung, die Sie durch die Mandoki Soulmates erfahren haben, heute über die Schlager von damals hinwegsehen?
Ja, natürlich. Ich habe diese Lieder zwar seit über 40 Jahren nicht mehr gesungen, beantworte diese Frage aber gerne mit einer kleinen Anekdote. Als unsere erstgeborene Tochter Lara, die heute eine großartige Schauspielerin ist, fünf Jahre alt war, hat sie mal unsere Bibliothek auseinandergenommen. Ich kam gerade vom Tonstudio nach Hause, alles lag auf dem Boden – darunter auch ein Buch über die Gruppe Dschinghis Khan. Sie war überrascht, mich in diesen Kostümen zu sehen, weil sie wusste, dass ich eigentlich ein Faschingsmuffel war. Sie sagte zu mir: „Du magst doch keinen Karneval.“ Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass ich meinen Kindern nie erzählt hatte, dass ich mal ein Pop- oder Schlagerstar war. Heute kann ich sehr entspannt darüber sprechen und muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich daran zurückdenke.
Warum waren Sie eigentlich nie Jurymitglied in einer Castingshow?
Ich hätte keine Freude daran, junge Menschen, die sich dort präsentieren, niederzumachen. Mein Berufsethos nehme ich sehr ernst. Ich habe überhaupt nichts gegen meine Kollegen, die in Jurys sitzen. Aber für mich sind Castingshows eher Fernsehformate, die mit Musik wenig zu tun haben. Meine Plattform ist das nicht. Ich fördere Talente lieber im stillen Kämmerlein in meinem Tonstudio, und freue mich, wenn wir ein gutes Debütalbum erarbeiten können, das beim Publikum Anklang findet. Ich produzierte zum Beispiel die No Angels, die allererste Gruppe, die durch eine Castingshow entstand.
Über den Gesprächspartner
- Leslie Mandoki ist ein ungarisch-deutscher Musiker und Musikproduzent. Im Jahr 1953 in Budapest geboren, verließ er Mitte der 70er-Jahre sein Heimatland über Österreich nach Deutschland. Bekanntheit erlangte er als Mitglied der von Ralph Siegel produzierten Band Dschinghis Khan, die beim damaligen Grand Prix Eurovision de la Chanson mit dem Lied „Moskau“ den vierten Platz belegte. Im Jahr 1992 gründete er sein musikalisches Projekt, die Mandoki Soulmates. In seiner Karriere arbeitete Mandoki mit nationalen und internationalen Stars zusammen, darunter Engelbert, Phil Collins, Jennifer Rush oder Lionel Richie.


„So arbeitet die Redaktion“ informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.